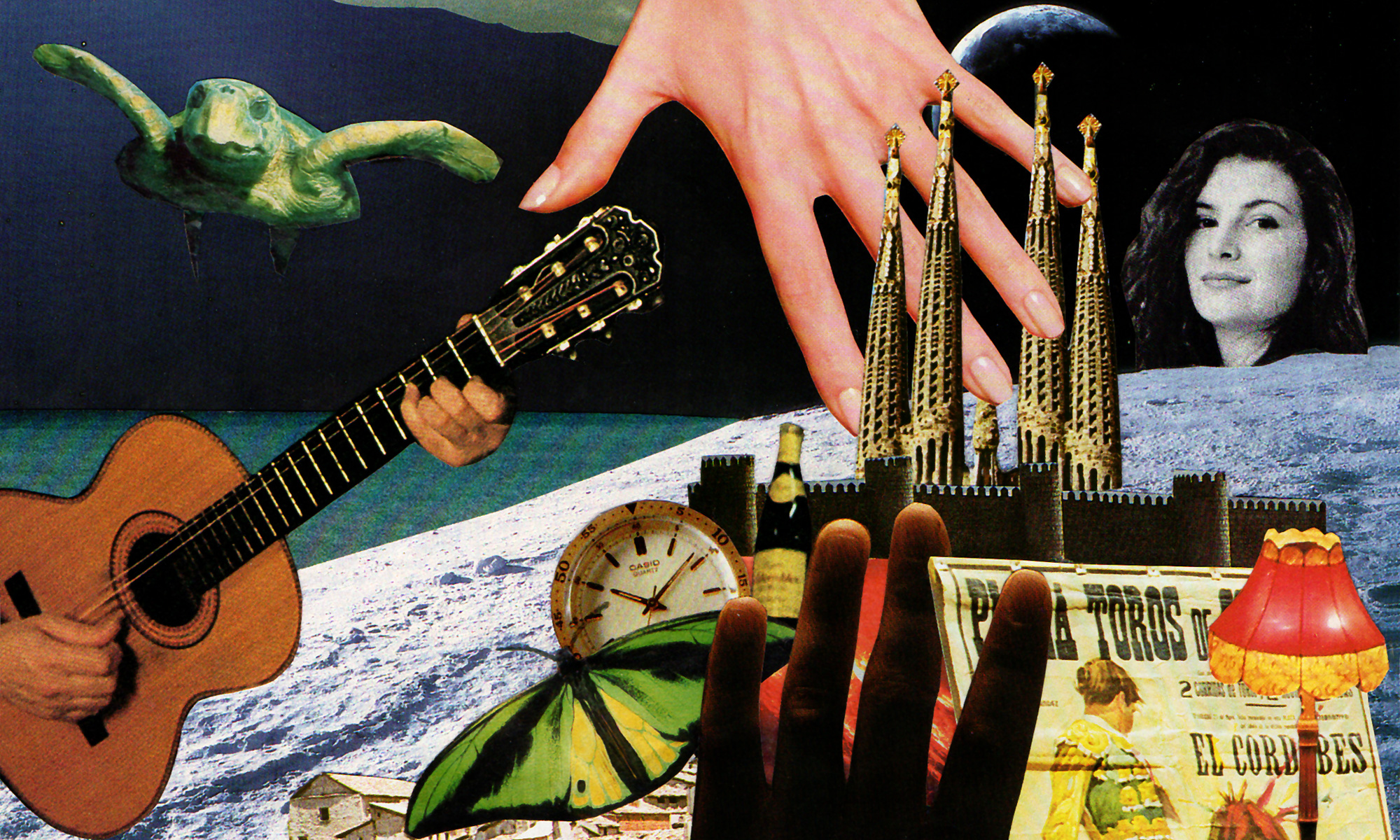.. vom Lande öfters in die Stadt fahren, irgendwas Geschäftliches. Dabei nutzte er stets die öffentlichen Verkehrsmittel der Menschen, und das gerne. Denn: Laufen tat er noch genug. Vom Wald - mittendrin, in dem er mit seiner Zwergenfrau in einem schnuckeligen Holzhaus mit Garten drumherum wohnte, zu Fuß ins Dorf, ein schöner Weg und Marsch - dauerte es gut vierzig Minuten. Nicht zu vergessen, der Rückweg. Doch das machte dem Zwerg nichts aus. Denn mit seinen robusten Stiefeln war er ein sehr guter Wald- und Wiesen-Läufer, ein geübter flotter Hügel-rauf-Hügel-runter-Marschierer und überhaupt ein passionierter Wanderer.
Ab der Bushaltestelle am Dorfplatz wurde es für ihn bequem. Mit dem Landbus fuhr er eine knappe halbe Stunde zum Stadtrand, zum Endhaltepunkt der Stadtbahn, die ihn dann in zwanzig Minuten direkt ins Herz der Stadt beförderte. Stets genoss er es, sich im Sitzen transportieren zu lassen und dabei aus dem Fenster in die Welt zu gucken. Oder auch mal für einige Momente wegzudösen.
Tagsüber, auf der Hinfahrt, fuhr der Landbus öfter, ungefähr stündlich. Am Nachmittag, auf der Rückfahrt zurück aufs Land, sah das schon anders aus, da bereits dünnte die Verkehrsanbindung aus. Wenn der Zwerg am fortgeschrittenen Nachmittag am Stadtbahn-Endhaltepunkt ankam, musste er meist eine halbe bis dreiviertel Stunde auf den Bus nach Hause warten. Spät abends fuhr gar kein Bus mehr nach Hause, den letzten sollte man also nicht verpassen.
Der Stadtbahn-Endhaltepunkt, eine zweckmäßige Beton-Stahl-Stein-Architektur von schlichter Hässlichkeit, war zugig-luftig und bot nur wenige Sitzgelegenheiten, die auch nur mäßig vor Wind und Wetter schützten. Meist war es zugig. Im Sommer durchaus angenehm bei lauen, leicht kühlenden Winden, im Winter eisig und bitterkalt.
Nun also der ungemütliche Herbst und der Zwerg, der an fortgeschrittenen Nachmittagen aus dem Stadtzentrum am Stadtbahn-Endhaltepunkt ankam und auf den Bus nach Hause warten musste. Zum Glück befand sich schräg gegenüber vom Umsteigepunkt ein Gartencenter. Und da ging er gerne hin. Was bedeutete: Kein Wartezeit-Frösteln, Windschutz, Regenschutz, Wärme, viel Augenfutter und für das weitere Kunden-Wohlbefinden, durchgehend dahinplätschernde "Tut-den-Ohren-nicht-weh"-Hintergrundmusik.
Jedes Mal, wenn der Zwerg in das Gartencenter ging, erfreute er sich an den Schnittblumen, Blumentopfpflanzen, Kakteen, Orchideen, Palmen, Gräsern, Farnen sowie an den glänzenden, blitzsauberen, noch unbenutzten Gartengeräten und an vielen weiteren Produkten. Ebenso schaute er auch stets bei den Aquarien mit den Zierfischen und bei den Vogelvolieren mit den munter zwitschernden Wellensittichen vorbei.
Eines Tages aber war etwas anders. Zusätzlich zum bekannten vielfältigen Angebot, standen nun im ganzen Gartencenter verteilt, aus Ton geformte, farbig bemalte Figuren herum. Zur Zierde, zur Auflockerung, zum Kauf. Absolute Hingucker, die die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich lenkten. Eine Bereicherung der Produktpallette und zudem eine sehr clevere Marketingstrategie, dachte der Zwerg beeindruckt, als er vor einer dieser immer gleichen Tonfiguren stand, die fast so groß war, wie er selbst. Dass sie alle wie geklont aussahen, störte ihn nicht im Geringsten. Ja, diese Figur mit dem fröhlichen Lächeln gefiel ihm, sehr sogar. Schon beim ersten Anblick, gestand er sich ein. Diese Figur war einfach gut gegen schlechte Laune, so meinte er. Gespannt schaute er nach dem Preisschild. Es klebte auf dem Figurenrücken. Er las: Standzwerg 22,95. Aha, die Figuren waren also Standzwerge. Sie mussten neu sein, denn er hatte sie noch nie zuvor gesehen. Der Preis erschien ihm fair und angemessen. Aber jeder Kauf sollte gut überlegt sein. Und so ging er weiter umher, grübelte dabei und traf immer wieder auf diese lustigen Gesellen, die, wie er, eine rote Zipfelmütze trugen. Dann wurde es Zeit, zum Bus zu gehen.
Zuhause angekommen - Zipfelmütze runter, Jacke und Stiefel abgestreift - begrüßte der Zwerg seine Frau, die in der Küche das Abendessen zubereitete. Dann ging er ins Bad, wusch sich die Hände, huschte ins Wohnzimmer, schaute kurz die wenige Post durch, für ihn war nichts dabei, gut, setzte sich an den Wohnzimmertisch, fummelte seinen Geldbeutel aus der Hosentasche, schüttete sein gesamtes Geld aus und begann die Geldstücke zusammenzurechnen.
"Abendgessen!", rief seine Frau.
"Ich komme gleich...", antwortete er. Wieviel war das jetzt? Nochmal. Der Zwerg begann sein Geld erneut abzuzählen.
"28,63.", murmelte er vor sich hin. Aber stimmte der Betrag wirklich? Nochmal. Zur Sicherheit. Hochkonzentriert zählte er wieder sein Geld ab.
"Wo bleibst du denn? Das Essen wird kalt!"
"Jaaa, gleich!", antwortete der Zwerg genervt und rechnete weiter. Aber er war sich unsicher, daher rechnete er alles noch einmal zusammen. Bei Geldangelegenheiten soll man genau sein, sicher ist sicher, ermahnte er sich. Geschafft.
"28,63. Stimmt also."
"Nun komm doch!"
"Bin doch schon auf dem Weg!"
Zügig tat er sein Geld in den Beutel zurück, stand geschwind auf und begab sich eilig in die Küche.
"Wo du nur immer bleibst.", bemerkte seine Frau kopfschüttelnd.
"Bin doch da.", sagte der Zwerg und setzte sich an den Küchentisch.
"Immer muss ich dich mehrmals rufen!"
"Riecht lecker!", bemerkte er zufrieden und probierte die dampfende Bohnensuppe mit Käferflügeln und Regenwurmstücken.
Zwei Tage später kam der Zwerg früher aus der Stadt. Der gleich abfahrende Bus nach Hause interessierte ihn nicht. Schnurstracks ging er durch den Nieselregen zum Gartencenter und tauchte in die wohlig-warme Verkaufswelt des Garten-Zubehörs ein. Die Standzwerge waren noch da und zogen ihn gleich wieder in den Bann. Ja, dieses unbeschwerte, fröhliche Lächeln hob sofort seine Laune und ließ alles um ihn herum leichter erscheinen. Er schlenderte umher und begutachtete die Standzwerge. Dann blieb er bei einer Figur stehen, die unter einer Palme stand. Es schien ihm, als ob dieser Standzwerg, im Gegensatz zu seinen Klon-Kameraden, eine Nuance heller, breiter und fröhlicher lächelte.
Ja, diesen auserwählten Gesellen wollte er nun genauer unter die Lupe nehmen. Sofort ging es ans Eingemachte. Beim TÜV hätten sie die Standzwerg-Komplett-Untersuchung auch nicht gewissenhafter durchführen können...
Mit gespitzten Ohren klopfte er die Figur Stück für Stück ab. Sie klang hohl, wohlklingend, schien stabil und fest. Auch die Standfestigkeit überprüfte er genauestens. Kein Kippeln, sehr gut. Dann untersuchte er akribisch die Farblasur, die war tadellos. Abschliessend kam noch der Gesamteindruck von allen Seiten auf den Prüfstand, der Zwerg mit Adlerblick. Nein, hier gab es absolut nichts zu meckern. Im Gegenteil, alles sah bestens und professionell aus. Fazit: Diese tönernde, geradezu klassische Skulptur mit ihrem formvollendeten Design war "Top-in-Ordnung". Im Geiste vergab der Zwerg feierlich das Gütesiegel höchster Klasse: "1A mit Sternchen".
Ein letzter scharfer Blick, ein kaum sichtbares, kurzes bejahendes Kopfnicken mit einem leise vor sich hin gemurmelten "Ja!" für sich selbst - und die Entscheidung war gefallen. Ein Zwerg, ein Wort. Kein Zweifel: Diese Investition musste sein. Ausserdem, so kam es im in den Sinn, würde er mit diesem aussergewöhnlichen Gegenstand zugleich auch hochrangige Kunst erwerben! Einen kommenden Skulpturen-Klassiker! Da war er sich absolut sicher. Und zu einem exzellenten, ja geradezu sensationellen Schnäppchen-Preis - den man lieber für sich behalten sollte. Was für ein Glück! Den Zwerg durchströmte ein wohlig-warmes Gefühl, denn dieser Standzwerg würde ihn sein gesamtes Leben begleiten. Auch darin war er sich sicher. Und seine Frau würde ihn ganz bestimmt auch mögen. Hoffte er...
Mit beherztem Griff packte der Zwerg den Standzwerg, buckelte ihn sich auf seine Schulter und marschierte schwerer atmend zur Kasse. Das Teil wog, aber das sprach doch auch für seine Qualität.
"Das soll's sein?", fragte die junge Aushilfskassiererin mit den großen Ohrringen und den überlangen, hellrosa-farbenen künstlichen Fingernägeln.
"Ja, bitte.", sagte der Zwerg angestrengt, während er den Standzwerg behutsam auf das Transportband legte. Er schwitze. Dann griff er in seine Hosentasche und holte seinen Geldbeutel hervor. Das Transportband bewegte den Standzwerg zu der jungen Frau, sie schaute nach dem Preisschild.
"Ist ein lustiges Teil, nicht?", bemerkte sie leicht lächelnd.
Der Zwerg schaute überrascht und dachte: "Die hat ja Null Ahnung von Kunst und Hochkultur."
"Zweiundzwanzigfünfundneunzig."
"Moment bitte.", bat der Zwerg, zählte langsam und konzentriert seine Geldstücke bis zum benötigten Betrag ab und übergab sie in die krallenhafte Hand der jungen Kassenfrau. Die zählte alles noch einmal flott nach und verteilte die Geldstücke ebenso flott in der Kasse, ohne ihre langen Fingernägel in Mitleidenschaft zu ziehen.
"Beleg?"
"Ja, bitte.", antwortete der Zwerg, nahm den ausgedruckten Beleg aus der Kralle entgegen und stopfte ihn zusammen mit seinem Geldbeutel tief in seine Hosentasche. Dann schulterte er sich den Standzwerg wieder auf. Die junge Aushilfskassiererin schaute skeptisch.
"Wiedersehen.", sagte der Zwerg. Doch die junge Frau wendete sich bereits dem nächsten Kunden zu. Der kaufte keine Kunst.
"Bis zum Bus, ich muss es jetzt nur bis zum Bus schaffen.", motivierte sich der Zwerg selbst und keuchte. Er schwitzte nun ganz schön stark, aber was tut man nicht alles für die Kunst. Der Nieselregen hatte in der Zwischenzeit aufgehört, aber das Einheitsgrau des Himmels war geblieben.
Der Bus war schon vorgefahren. Die Fahrgäste saßen bereits auf ihren Plätzen und warteten auf die Abfahrt. Der Zwerg musste sich beeilen. Doch er schaffte es, da der Bus noch auf eine Stadtbahn wartete.
"Muss ich für den Standzwerg eine Fahrkarte lösen?", fragte der Zwerg den gelangweilt dreinschauenden Busfahrer. Aber der schüttelte nur verneinend mit dem Kopf und wunderte sich über den schwitzenden Zwerg, der sich mit einem Standzwerg abplagte.
Der Zwerg war froh, daß er ein zusätzliches Fahrgeld sparen konnte. Die Stadtbahn kam, entließ ihre Fahrgäste und einige von ihnen huschten schnell in den Bus. Dann begann die Rückfahrt, die der Zwerg genoss, obwohl er sicherheitshalber den Standzwerg die gesamte Fahrzeit festhielt, damit dieser nicht umkippen konnte. Während dieser Zeit kehrten auch seine Kräfte langsam zurück. Das war auch nötig, denn die würde er noch brauchen.
Der lange Weg von der Dorfplatz-Bushaltestelle bis nach Hause in den Wald war eine einzige Plackerei. Der Zwerg brauchte für seinen Fußmarsch fast dreimal länger als sonst. Denn der Standzwerg wurde ihm schon nach kurzer Zeit immer schwerer. Schon in der Neubausiedlung musste er seine neuerworbene Skulptur mehrfach absetzen. Er schwitzte wie ein Ochse, Arme, Schultern und Nacken schmerzten. Immer wieder war er gezwungen, den fröhlich lachenden Standzwerg von seinen Schultern zu nehmen und zu pausieren. Und so manche Person, die vorbeikam, wunderte sich über die beiden Zwerge, weil der eine starr und fröhlich lachend mitten auf dem Weg stand und der andere erschöpft auf dem Bordstein saß. Ab und an blickte auch mal jemand hinter den Gardinen hervor, wenn der Zwerg mit seinem kommenden Kunstklassiker auf den Schultern vorbeischlurfte. Doch all das machte ihm nichts aus. Er hatte nur ein Ziel, nämlich den Standzwerg, dieses wunderbare Kunstwerk, dass auch noch ein Schäppchen war, unversehrt nach Hause zu bekommen. Dass mit der durchaus verständlichen Neugier der Leute erledigte sich, als er die Neubausiedlung hinter sich ließ.
Der Weg zwischen den weiten Feldern kam ihm noch nie so lang vor. Er musste viele, kleine Pausen einlegen. Auch, weil nun seine Füsse schmerzten. Der Vorteil aber war, hier draußen liess es sich unbeobachteter gehen und schleppen. Bis auf einmal, am Waldesrand. Da kam eine ältere Dame auf ihn zu, die ihren Hund Gassi führte. Der Zwerg machte gerade wieder Pause, saß durchgeschwitzt auf einem Baumstumpf am Wegessaum und hatte zuvor den Standzwerg mitten auf dem Weg abgestellt. Die ältere Dame schaute gleichgültig den Standzwerg an und ging weiter, doch der Hund freute sich über den neuen bunten Baum und wollte gerade gegen den Standzwerg pinkeln. Aber Frauchen, die unbeeindruckt ihren Weg fortsetzte, zog ihren Vierbeiner einfach weiter.
"Glück gehabt.", dachte der Zwerg und raffte sich auf, um den Standzwerg in Sicherheit zu bringen. Ausserdem wurde es langsam dunkler.
Nun war es nicht mehr allzu weit bis zu dem kleinen Holzhaus, das auf einer Lichtung inmitten einer Tannenschonung stand. Der Zwerg ging noch einen längeren Waldweg entlang, bis er dann, plötzlich, in die dichte, dunkle Tannenschonung eintauchte. Hier gab es keinen erkennbaren Weg mehr. Dieser letzte Teil seines Weges wurde allerdings beschwerlicher, da er den Standzwerg durch die niedrig hängenden Tannenzweige und pieksenden Tannennadeln hindurch manövrieren musste. Das kostete noch einmal viel Kraft und nötigte ihn weitere Verschnaufpausen ab. Aber, wie erwähnt, was tut man nicht alles für die Kunst.
Doch irgendwann ist auch der längste Weg einmal zu Ende. Mit dem letzten Tageslicht kam der Zwerg zu Hause an. Völlig erledigt öffnete er die Tür zum Vorgarten, schleppte sich noch bis zur Haustür, stellte dort vorsichtig den Standzwerg ab und holte seinen Hausschlüssel aus seiner Manteltasche hervor. Dann öffnete er die Haustür, wuchtete sich wieder den Standzwerg auf die schmerzenden Schultern und trug ihn gleich ins Wohnzimmer, wo er ihn mitten im Raum abstellte.
"Das wäre geschafft", dachte der Zwerg glücklich.
Dann ging er erleichtert zurück in den Flur, schloss die Haustür, zog sich seine verschwitzte Zipfelmütze vom Kopf, zog den Mantel und die schweren Stiefel aus, ging ins Badezimmer und wusch sich mit frischem, kalten Quellwasser. Er machte das Fenster ganz auf und sah seine Frau mit einer Laterne in der Hand im Kräutergarten Kräuter aussuchen.
"Bin wieder da, mein Schatz!"
"Heute bist du aber spät."
"Hat sich so ergeben."
"Wir können auch bald essen."
"Sehr schön. Hab' einen Bärenhunger."
Der Zwerg schloss das Badezimmerfenster, zog sich um und ging ins Wohnzimmer. Dort setzte er sich gemütlich in seinen geliebten, abgewetzten Ohrensessel, atmete zufrieden tief durch und betrachtete lächelnd sein neu erworbenes Kunstwerk.
"Was für ein Prachtexemplar!", murmelte er voller Besitzerstolz vor sich hin.
Plötzlich tauchte seine Frau in der Wohnzimmertür auf.
"Huch!", erschrak sie laut. "Was um Himmels Willen ist denn DAS?"
[...]
einklappen